Die Themen dieser Website sind letztlich eine Arbeit an dem „roten Faden“ meines Lebens, diesen zu (er-)finden und weiter zu spinnen. Seit meinem jungen Erwachsenenalter beschäftige ich mich auf unterschiedliche Weise, mit unterschiedlichen Schwerpunkten mit dem, was ich früher eher „Suche nach Sinn“ und heute „Sorge um sich“ nennen würde, für das es aber noch viele weitere Begriffe und Bilder gibt – und eben auch viele Theorien und Praxen, Anregungen und Übungen, die ich auf dieser Website ausarbeiten und sammeln will.
So gab es diesen „roten Faden“ während der rund 15 Jahre meines Lebens in einer Community oder Kommune, wo wir die Selbst-Erkenntnis, Selbst-Verwirklichung und Selbst-Erschaffung sowohl theoretisch als auch praktisch zu erforschen versuchten, also auf wie man so sagt, ganzheitliche Weise oder mit Kopf, Herz, Hand und Geist.
Danach fand sich dieser Faden im Rahmen meines Bachelor- und Masterstudiums der Kindheitswissenschaften/Kinderrechte und zeigte sich beispielsweise in Fragen, wie/ob eine Emanzipation/Selbstermächtigung des Menschen vielleicht gefördert oder gar erst ermöglicht werden kann über „alternative“, reformierte Erziehungsvorstellungen und -praktiken, Menschen- und Kind-Bilder, Institutionen und (politische) Programme. Der Mensch zwischen Fremd- und Selbstbestimmung, zwischen struktureller Benachteiligung und Eigenverantwortung oder Selbstermächtigung.
In Michel Foucault fand ich einen Autor/Denker, der mir – wie ich zunehmend überzeugt bin und mit wachsender Begeisterung entdecke – in dieser Hinsicht sehr nahe ist:
Laut Frédérik Gros betonte Foucault in seinen letzten Schaffens- und Lebensjahren:
‘Nicht die Macht, sondern das Subjekt ist das Thema meiner Forschungen.‘ Oder auch: ‚Ich bin gar kein Theoretiker der Macht.‘ (…) Foucault gibt die Politik nicht etwa auf, um sich der Ethik zu widmen, sondern er bereichert und kompliziert die Untersuchung der Gouvernementalitäten durch die Erforschung der Sorge um sich selbst. Auf gar keinen Fall werden Ethik und Subjekt als das Andere von Politik und Macht gedacht. Foucault beginnt seine Vorlesung des Jahres 1981 wie auch die des Jahres 1982, indem er daran erinnert, daß die Beziehung des Subjekt zur Wahrheit von jetzt an der allgemeine Angelpunkt seiner Forschung sei und daß die Sexualität ein Kristallisationspunkt unter anderem darstelle1.
Zur Bedeutung der Vorlesung des Jahres 1982, die der „Hermeneutik des Subjekts“ gewidmet war, schreibt Gros:
Sie [die Vorlesung] tritt gleichsam an die Stelle eines geplanten, durchdachten, aber niemals erschienenen Buches, das ganz den Selbsttechniken gewidmet sein sollte, in denen Foucault am Ende seine Lebens die theoretische Krönung seines Schaffens sah, so etwas wie dessen Vollendungsprinzip. (…) die Selbstpraktiken (…) werden dargestellt als das Organisationsprinzip seines gesamten Werkes und als bereits seine ersten Schriften durchziehender roter Faden. Foucault – und das ist das Geheimnis seines Verfahrens – reihte nicht Themen aneinander, sondern folgte einer hermeneutischen Spirale2.
Diese Einordnung und Bewertung war auch ein Ergebnis meiner Analyse von Foucaults Überwachen und Strafen3. Es ist eine häufige, aus meiner Sicht jedoch zu einseitige Rezeption von Überwachen und Strafen, wie sie sich beispielsweise bei Lemke et al. findet, dass bei Foucault bis „hin zu Überwachen und Strafen und Der Wille zum Wissen“ der „Akzent der Genealogie (…) allein auf dem Körper und seiner disziplinären Zurichtung“ gelegen habe, „ohne den umfassenden Prozessen der Subjektivierung Beachtung zu schenken.“4 Eine Interpretation, die auch der Einschätzung von Markus Rieger-Ladich widerspricht, der vier Jahre später schreibt, Überwachen und Strafen sei der „Text, der die Subjektivierung am gründlichsten analysiert und in ihrer Bedeutung am nachdrücklichsten herausstellt“.5
Noch einmal Foucault in seinen eigenen Worten (zitiert nach Gros):
Im großen und ganzen geht es darum, sich auf die Suche nach einer anderen kritischen Philosophie zu machen: einer Philosophie, die nicht die Bedingungen und Grenzen der Objekterkenntnis definiert, sondern die Bedingungen und die unbegrenzten Verwandlungsmöglichkeiten des Subjekts.6
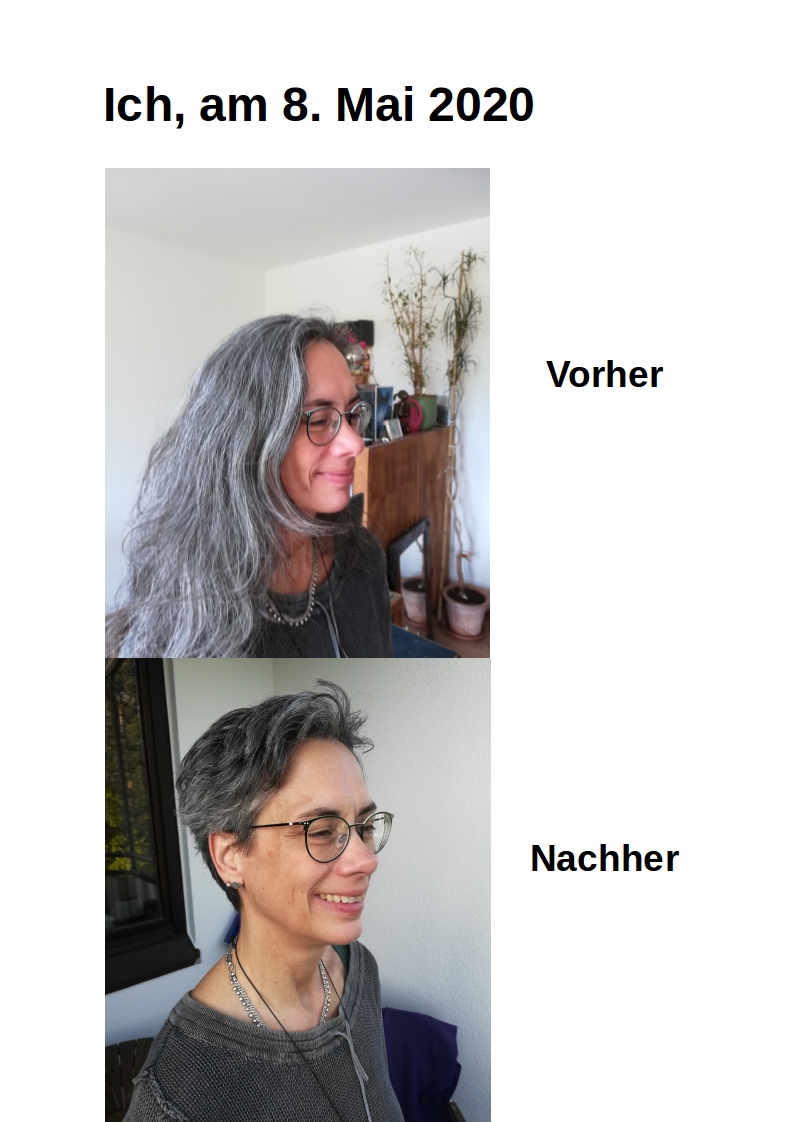
1 Michel Foucault, Hermeneutik des Subjekts. Vorlesungen am Collège de France (1981/82). suhrkamp taschenbuch wissenschaft, 4. Aufl. 2019 (1. Aufl. 2009), S. 622 f.
2 Ebd., S. 627.
3 Vgl. Buchner, Priska (2019): Emanzipation und Disziplinierung. Masterthesis, URL: Emanzipation und Disziplinierung | Sorge um sich (sorge-um-sich.de).
4 Lemke, Thomas; Krasmann, Susanne; Bröckling, Ulrich: Gouvernementalität, Neoliberalismus und Selbsttechnologien. Eine Einleitung. In: Bröckling, Ulrich; Krasmann, Susanne; Lemke, Thomas (Hrsg.) (2000): Gouvernementalität der Gegenwart. Studien zur Ökonomisierung des Sozialen. Frankfurt/Main: Suhrkamp. S. 7 – 40. S. 8.
5 Rieger-Ladich, Markus: Unterwerfung und Überschreitung: Michel Foucaults Theorie der Subjektivierung. In: Ricken, Norbert; Rieger-Ladich, Markus (Hrsg.) (2004): Michel Foucault: Pädagogische Lektüren. Seiten 203-223. S. 205.
6 Foucault, Hermeneutik des Subjekts, a.a.O., S. 642.